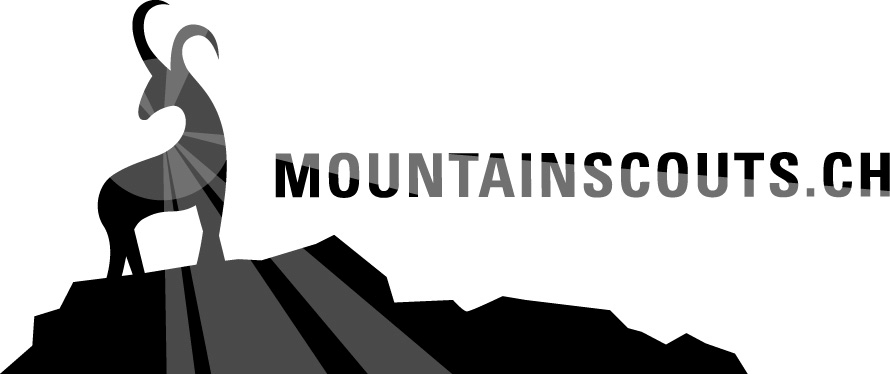Was machen Mountainscouts in den Ferien, die tagsüber nicht am Strand und nachts nicht in der Disco hangen mögen? Sie verfallen dem Abenteuer wie einst die Hobbits in „Herr der Ringe“. So stürze ich mich in ein Bergabenteuer mit achtzehn Gefährten. Und dann ist noch die Stimme in meinem Kopf.
Die Seilschaft
„Klettern macht keinen Spass!“ Meine Füsse schmerzen, die Angst zu fallen sitzt mir im Nacken. Krampfhaft suche ich die nächste Ritze, den nächsten Griff, das nächste irgendetwas in dem ich meine Finger verklemmen kann. „Nur nicht los lassen!“ Mit dem Fuss suche ich Halt auf der steilen Granitplatte. Tritte hat es fast keine, da und dort Unebenheiten im sonst glatten aber rauen Fels. Doch die genügen. Der Fuss hält. Ich rutsche nicht. Wider Erwarten gibt die Reibung zwischen den Gummisohlen und dem Fels meinen Füssen stabilen Halt. Ganz traue ich der Sache aber nicht. Bis zur nächsten Öse für das Seil fehlen mir noch zwei Meter. „Das ist die letzte Route für heute“. Luft hohlen und weiter. Expressschlinge einhängen, Seil nachziehen und einhängen. Augenblicklich fühle ich mich sicherer.
„Stand!“ rufe ich mit zittriger Stimme, als ich mich mit meiner Bandschlinge am metallenen Ring gesichert habe. „Geschafft, ich bin oben.“ Ich schaue stolz und erleichtert nach unten und sehe wie Steffi, meine Partnerin in der Seilschaft, meine Sicherung löst und sich für den Nachstieg vorbereitet. Mit einer Bandschlinge hänge ich sicher in meinem Sitzgurt. Der richtige Augenblick, die Aussicht zu geniessen. Aus dem Felsen schiessen tosende Wasserfluten, herbeigeführt aus einem Seitental. „Nur Zwerge können derlei lange Kanäle in den Fels hauen.“ Unten zerstreut sich der Fluss im schneeweissen Gletschersand. Kein Grashalm wächst in der kargen Moränenlandschaft. „Wie auf dem Mond.“ Die Menschen unter mir gleichen Ameisen, bunten Ameisen bis an die Zähne bewaffnet mit Helm, Schlingen, Karabinerhaken, Seilen und anderem nützlichen Gerät.
Steffi ist bereit. Vorsichtig steigt sie hoch, tastet nach einer griffigen Ritze. Jetzt sieht es ganz einfach aus. Wo ich gezittert und geschwitzt habe, scheint sie mit Leichtigkeit durchzusteigen. Derweil suche ich mit meinen Füssen bequemen Halt in einem Felsspalt. Meine Zehen spüre ich kaum. Sie fühlen sich taub an in den Kletterfinken, die gar nicht bequem wie Finken sind. „Komm hoch, so kann ich wieder runter.“
Wir seilen ab und kurz darauf sind wir unten, ziehen sofort die engen Schuhe aus und lassen die eingepferchten Zehen in die Freiheit. Nebenan üben sich Kinder. Mit kindlicher Selbstverständlichkeit kraxeln oder eher spazieren die Kleinen hoch. „Eine Frechheit!“ Ehrfürchtig schaue ich derweil nach oben, im Kopf durchsteige ich nochmals die heiklen Stellen. „Es ist eigentlich nicht schwierig, nur der Psycho-Stress im Kopf“, sagt Steffi. Sie liest meine Gedanken.
Die unendliche Treppe
Der Boden ist feucht. Da und dort wächst ein Föhre neben hausgrossen Felsbrocken. Sie sind gezeichnet von Wind und Wetter, verwachsen und knorrig, wahrscheinlich uralt und doch klein und mickrig geblieben. Ein Murmeltier pfeift irgendwo. Die Felswände werfen ein mattes Echo zurück. Ein schmaler, steiniger Weg schlängelt sich durch das Heidekraut.
„Auf ins nächste Abenteuer.“ Wir ziehen zu Fuss weiter. Die Gelmerhütte des SAC ist unser Ziel. Wir lassen die blühenden Erika hinter uns. Von den letzten Heidelbeersträuchern pflücken wir ein paar reife Beeren. Bis zur Gelmerhütte ist es noch ein gutes Stück. Nach einer Stunde Aufstieg strahlt uns der türkisfarbene Gelmersee an. Das Wasser ist klar und erinnert mich an die Karibik. Weiss leuchtet der Firn unter den Bergkuppen. Tosende Bäche ergiessen sich aus den Gletscherzungen durch die Felsen hinab in den See. Wo vor kurzem noch ein Pfad war, suchen wir einen Weg über Steine, die aus dem wilden Bach ragen. Die Natur zeigt ihre Kraft. Wir gehen weiter.
Jetzt geht es erbarmungslos bergauf. Über drei mächtige Stufen stürzt das Wasser herab. Der Fels ist vom Gletscher blank poliert. Schritt für Schritt nehme ich die unendliche Treppe unter die Füsse. Die Sonne brennt. Der schwere Rucksack drückt. „Doch, ich brauch wirklich alles!“
Die Gruppe reist auseinander. Jede und jeder geht im eigenen Tempo, sucht den eigenen Rhythmus und steigt über Felsbrocken, die von fleissigen Händen zu einem Weg geformt wurden, an Wegmarken und Steinmännchen vorbei der Hütte entgegen. Meine Beine schmerzen. Der Berg zeigt kein Erbarmen. Vereinzelt grinsen mir Disteln entgegen. Ich höre die Dornen voller Hohn: „Nur weiter und nicht stehen bleiben.“ Doch genau das will ich. „Noch einen Schritt“, sage ich mir nach jedem, „noch einen.“ Die Bergwelt verblasst, verschwindet aus meinem Blick. Unten lächelt zwar der See in seinem schönsten türkis, doch ist es mir egal. Stattdessen kommen mir Lieder aus der Schule in den Sinn: „500 Miles, 500 Miles,…“
Etwa nach der dritten Wiederholung des Refrains taucht sie plötzlich auf. Auf einem kleinen Vorsprung klebt sie – die Gelmerhütte. Das graue Häuschen in der grauen Wüste ist unscheinbar, doch ich sehe es deutlich. Stolz winkt die rote Schweizer Fahne im Wind und ruft mich zu sich. „Los, lauf!“
Die Heimkehr
Wie tausend Nadelstiche fühlt sich der Schneefall im Gesicht an. „Wir kehren um!“ Enttäuscht aber einsichtig fassen wir den Entschluss. Über Nacht hat das Wetter umgeschlagen. Der Himmel hängt tief, dunkle Wolken drücken. Der Wind bläst uns eisige Gletscherluft entgegen. Nebelschwaden steigen auf und verschlucken die Berge. Den Weg erkenne ich schon lange nicht mehr. Ich halte mich an die Fussstapfen im Schnee. Mir ist kalt. „So macht es keinen Spass.“
Einen Tag früher als geplant steigen wir von der Hütte ab. Das Abenteuer ist zu Ende. „Schade!“